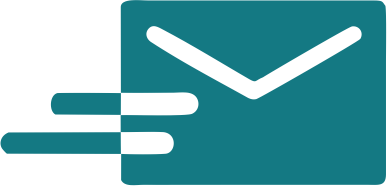06.04.2023
Mehr Aufwand und Bürokratie für alle Beteiligten
Zur geplanten Direktabrechnung bei Kindern und Jugendlichen in der PKV
Dr. Anke Schlieker, Projektleiterin Gesundheitsversorgung beim Verband der privaten Krankenversicherung
„Für Kinder und Jugendliche in der PKV soll zukünftig das Prinzip der Direktabrechnung gelten“ – so steht es im Koalitionsvertrag der Ampel. Sollte dieses Vorhaben wie jetzt mit den Versorgungsgesetzen geplant umgesetzt werden, heißt das für die Versicherten mehr Aufwand und Bürokratie. Es gehört deshalb auf den Prüfstand.
Im Gesundheitsministerium wird derzeit an so vielen Gesetzen gearbeitet, wie lange nicht. Mit auf der Liste sind die Versorgungsgesetze, die im Kern auf den ambulanten Sektor zielen und so viele Vorhaben umfassen, dass sie gar in zwei Gesetze – Versorgungsgesetz Teil I und Versorgungsgesetz Teil II – aufgeteilt werden sollen. Dabei hätte fast jeder der dort aufgeführten Punkte das Zeug für ein eigenes Gesetz.
Mit dem ersten Teil soll die „Medizin in der Kommune“ gestärkt werden, etwa durch Gesundheitskioske, kommunale Gesundheits- oder Primärversorgungszentren und die Bildung von Gesundheitsregionen. Im zweiten Teil soll es dann um das Ziel der „Stärkung des Zugangs zu gesundheitlicher Versorgung“ gehen. Im Fokus hier: die Verbesserung der ambulanten psychiatrischen Versorgung, die Sprachmittlung oder der direkte Zugang zum Physiotherapeuten für Versicherte.
Für die Private Krankenversicherung (PKV) ist insbesondere ein Vorhaben relevant: die Direktabrechnung für Kinder und Jugendliche, die auch Teil des Koalitionsvertrags ist. Dort steht etwas verloren auf Seite 88 nach ein paar Regeln zur Gesundheitsfinanzierung in der gesetzlichen Krankenversicherung dieser Satz: „Für Kinder und Jugendliche in der PKV soll zukünftig das Prinzip der Direktabrechnung gelten.“ Nicht mehr und nicht weniger. Ein Satz. 14 Worte. Ohne weitere Erklärungen. Außenstehende reiben sich verwundert die Augen. Direktabrechnung für Kinder und Jugendliche in der PKV? Woher kommt diese Forderung, von der man zuvor noch nie gehört hat? Welches Problem soll damit gelöst werden?
Um diese Fragen beantworten zu können, ist zunächst ein genauerer Blick auf das Kostenerstattungsprinzip in der PKV unumgänglich, das für Kinder und Jugendliche nach dem aktuellen Koalitionsvertrag ausgehebelt werden soll.
Privatversicherte bekommen eine Rechnung
Jedem und Jeder, der oder die eine private Krankenversicherung abschließt, ist das Prinzip klar: Privat Versicherte erhalten nach der Behandlung eine Rechnung vom Arzt. Dies unterscheidet die PKV mit dem Kostenerstattungsprinzip von der GKV, in der das Sachleistungsprinzip gilt. Die Rechnung wird anschließend beim Versicherungsunternehmen eingereicht und wenig später erfolgt die Erstattung auf das Konto. So ist es bei Erwachsenen, so ist es bei Kindern. Etwas umständlicher ist das Procedere bei Beamten und Pensionären, denn diese haben zwei Kostenträger: Die Beihilfe und die private Krankenversicherung. Sie müssen also immer zweimal einreichen, was aufwändig ist. Vor allem mit den Beihilfestellen: Dort muss häufig noch ein Antrag gestellt und ein Formular ausgefüllt werden, in dem alle Rechnungen für jedes Familienmitglied einzeln aufzulisten sind. Hinterher geht es oft noch in die Post. Große Beihilfestellen unterstützen die Kunden auch schon mit einer App.
In der privaten Krankenversicherung ist es unkomplizierter, dort ist kein Formular erforderlich. Die Rechnungen können eingescannt und per RechnungsApp an den Versicherer geschickt werden. Der Postweg geht natürlich auch. Nur nutzen diesen insbesondere jüngere Versicherte kaum noch. Die Belege gehen digital ein, werden durch den maschinellen Prozess gejagt, häufig voll- oder teilautomatisiert dunkelbearbeitet und das Geld wenig später aufs Konto erstattet. Der Ablauf geht so schnell vonstatten, dass der Versicherte die ausstehende Summe häufig nicht einmal vorstrecken muss, sondern in Ruhe die Erstattung abwarten kann und seinerseits erst im Anschluss daran den offenen Betrag an die Verrechnungsstelle des Arztes zahlt.
Im Rahmen des Ausbaus der Telematikinfrastruktur (TI) und der elektronischen Patientenakte (ePA) ist geplant, künftig auch die Arztrechnung als sogenannte „E-Rechnung“ als Fachanwendung aufzunehmen und diese entsprechend in die Systeme einzubinden. Sobald der Prozess steht, soll es noch einfacher gehen. Dann kommt die Arztrechnung direkt in die ePA des Versicherten und wird – sofern eine Erstattung gewünscht wird – von dort aus auf digitalem Wege direkt an die jeweilige Versicherung zur Erstattung weitergeleitet.

Quelle: PKV-Verband
Wenn nun der Gesetzgeber eine Direktabrechnung für Kinder und Jugendliche beabsichtigt, muss man bedenken, dass mit einem Anteil von 55 Prozent über die Hälfte der 1,3 Mio. Kinder und Jugendliche bis zum Alter von 16 Jahren, die in der PKV versichert sind, Beamtenkinder sind. Für sie besteht bei der PKV eine Restkostenversicherung, das sind üblicherweise 20 Prozent, manchmal auch nur 10 Prozent des Betrags. Den Löwenanteil übernimmt der „Dienstherr“, das heißt der Bund oder das jeweilige Bundesland im Rahmen die Beihilfe.
Nur 45 Prozent der versicherten Kinder und Jugendlichen haben einen 100-Prozent-Vollschutz. Für sie gibt es besondere Kinder- und Jugendtarife. Diese sind deutlich günstiger als die normalen Tarife in der privaten Krankenversicherung. So ist für die jüngsten Familienmitglieder der private Krankenversicherungsschutz bereits ab etwa 100 Euro im Monat zu haben. Ein Grund für die niedrigen Beiträge: Kinder sind in der Regel sehr günstige Patienten – außer den Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen verursachen sie kaum Kosten. Außerdem werden bis zum Alter von 21 Jahren noch keine Altersrückstellungen gebildet.
Vollschutz-Tarife mit Selbstbehalt
Für Kinder und Jugendliche gibt es eine Vielzahl von Tarifen, aus denen die Eltern wählen können. Einige Anbieter haben Kindertarife ohne Selbstbehalt, die Mehrzahl mit. Der Selbstbehalt regelt, welcher Eigenanteil pro Jahr selbst zu bezahlen ist, bevor es eine Kostenerstattung durch die Versicherung gibt. Je höher der Selbstbehalt, umso geringer der monatliche Tarifbeitrag. Welcher Selbstbehalt gilt, weiß der Versicherte und der Versicherer, aber nicht der behandelnde Arzt. Bei einem Selbstbehalt von 300 Euro beispielsweise werden die Kosten erst erstattet, wenn Rechnungen mit einem Gesamtbetrag von über 300 Euro für ein Kalenderjahr eingereicht wurden. Dann wird nicht der gesamte Rechnungsbetrag überwiesen, sondern nur der Teil, der den Selbstbehalt übersteigt. Zudem findet eine Rechnungsprüfung statt, bei der gegebenenfalls auch Positionen gekürzt werden.
Dies ist tägliches Geschäft in der PKV: Selbstbehalte und Beitragsrückerstattungen gehören zu den wichtigen finanziellen Anreizen für die Versicherten. Sie senken den Verwaltungsaufwand und sorgen dafür, dass unnötige Arztbesuche unterbleiben. Sinnvolle medizinische Früherkennungs- und Vorsorgeuntersuchungen sind übrigens meist ausgenommen, für sie gilt der Selbstbehalt nicht.
Mehr Aufwand und höhere Kosten für den Arzt
Bei genauer Betrachtung machen genau diese Besonderheiten eine Direktabrechnung für Kleinstrechnungen schwer umsetzbar. Denn der Arzt weiß ja nicht, wie der Patient versichert ist und wie hoch sein Selbstbehalt ist. Das muss ihn eigentlich auch gar nicht interessieren. Er weiß, wie hoch der Gesamtbetrag ist und diesen stellt er dem Patienten in Rechnung. Wenn nur ein Teilbetrag der Rechnung überwiesen wird, ist dem Arzt nicht geholfen. Im Gegenteil: Dadurch entsteht ein Mehraufwand, denn der Restbetrag müsste bei einem anderen Kostenträger oder beim Versicherten selbst eingefordert werden.
Und auch die Rechnungsstellung des Arztes läuft automatisiert über Verrechnungsstellen: Kaum noch ein Arzt schreibt seine Rechnungen selbst. Die Prozesse in der Praxis sind darauf abgestimmt: Patienten unterschreiben, dass sie mit der Datenweitergabe an die Abrechnungsstelle einverstanden sind und verpflichten sich, den ausstehenden Betrag zu überweisen. Wenn der Patient nicht zahlt, übernimmt die Abrechnungsstelle auch noch den Mahnlauf sowie das anwaltliche und gerichtliche Einziehungsverfahren. Diese Regel gilt übrigens nicht nur Privatpatienten, sondern auch für Kassenpatienten, die beispielsweise Zahnrechnungen oder Eigenanteile für individuelle Gesundheitsleistungen selbst zahlen müssen. Ein Sachleistungsprinzip, so wie man es von der GKV kennt, gibt es für solche Fälle also nicht. Juristisch gesehen handelt es sich um zwei Schuldverhältnisse mit verschiedenen Partnern: Erstens, dem Behandlungsvertrag, den Arzt und Patient schließen und für den die Rechnung ausgestellt wird und zweitens, dem Versicherungsvertrag zwischen dem Patienten (hier Versicherten) und seinem Versicherungsunternehmen. Eine gesamtschuldnerische Haftung ist also nicht möglich, da bei diesen beiden getrennten Schuldverhältnissen keine objektive Zweckgemeinschaft existiert.
Direktabrechnung für hochpreisige Rechnungen möglich
Eine Direktabrechnung zwischen Leistungserbringer und privaten Krankenversicherungsunternehmen gibt es in den Fällen, in denen der Rechnungsbetrag üblicherweise so hoch ist, dass der Versicherte diesen nicht verauslagen kann. Dies gilt standardmäßig bei allen Krankenhaus- und Stationär-Rechnungen. Diese werden über das branchenweite Klinik-Card-Verfahren abgerechnet, das dem Krankenhaus anzeigt, dass eine Kostenübernahme durch die PKV vorliegt. Darüber hinaus gibt es für andere hohe Rechnungen, etwa bei Arzneimitteln oder bei Hilfsmitteln ebenfalls direkte Wege. Diese sind im Einzelfall mit dem Versicherungsunternehmen zu klären, denn der Versicherte muss hierfür eine Abtretungserklärung ausfüllen, mit der er seinen Erstattungsanspruch an den Leistungserbringer abtritt.
Mit Hinblick auf vermeintlich bedürftige Versichertengruppen, denen man eine Verauslagung von Kosten ersparen wollte, wurde mit dem Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz 2021 ein Anspruch auf Direktabrechnung für Versicherte des Basis- und des Notlagentarifs gesetzlich verankert. Insgesamt etwa 130.000 Versicherte waren branchenweit 2021 in diesen beiden Tarifkonstellationen versichert, etwa 1,5 Prozent des gesamten Vollversichertenbestandes. Die Nutzung der Direktabrechnung jedoch tendiert gegen Null. Offenbar ist die Direktabrechnungsmöglichkeit sowohl für Ärzte als auch für Versicherte so bürokratisch und unattraktiv, dass sie von dieser Möglichkeit gar keinen Gebrauch machen wollen. Aus diesen Erfahrungen heraus sollte man heute also sehr genau überlegen, ob ohne Not und ohne Bedarf eine gesetzliche Vorgabe zur Direktabrechnung im Kinder- und Jugendlichen-Bereich neu geschaffen werden sollte.
Entgegen der landläufigen Annahme sind Kinder und Jugendliche auch nicht nur beim Kinderarzt in Behandlung. Nach einer Auswertung des PKV-Verbandes stammt nur jede dritte ambulante Arztrechnung von einem Kinder- oder Jugendarzt. Der Rest entfällt auf Fachärzte wie Zahnärzte, Augenärzte, Hals-Nasen-Ohren- oder Hautärzte sowie Labormediziner. Auch Allgemeinmediziner und eine hohe Unbekannte ohne entsprechende Arztbezeichnung sind darunter. Mit einer Direktabrechnungsmöglichkeit hätte man es damit mit fast allen Arztgruppen zu tun, die entsprechend gefordert wären. Dass diese Regelung auf Gegenliebe trifft in Zeiten, in denen man ja eigentlich nicht mehr, sondern weniger Bürokratie fordert und insbesondere Kinder- und Jugendärzte entlasten möchte, darf bezweifelt werden.
Klarheit über politische Motive schaffen
Zudem müssten rechtliche und organisatorische Lösungen für Beihilfeberechtigte gefunden werden. Denn auf die „dienstliche Erklärung“ des Beihilfeberechtigten, dass die Voraussetzungen für eine Leistungsgewährung vorliegen, können die Beihilfeträger nicht verzichten. Ein System, das vermeintlich Vereinfachung verspricht, am Ende jedoch noch mehr Aufwand, eine Vervielfachung der Zahlungsströme und rechtlich notwendiger Erklärungen zwischen Ärzten, Beihilfestellen und Patienten erzeugen dürfte. Besser also, es erst gar nicht einzuführen.
Dennoch steht zu befürchten, dass sachliche Argumente die Politik derzeit nicht überzeugen. Welche Motive im Rahmen der Koalitionsverhandlungen dazu geführt haben mögen, diese Forderung aufzunehmen, ist unklar. Daher täte die Politik gut daran, ihre Motivation und ihr Handeln zu erklären und genau zu begründen, welcher Missstand mit der Änderung denn genau behoben werden soll. Gesetzliche Regelungen, die keine Probleme lösen und die für alle Beteiligten mehr Bürokratie bedeuten, gehen nach hinten los. Das sollten wir tunlichst vermeiden.
_observer.jpg)
Alle Beiträge Management/Trends ansehen