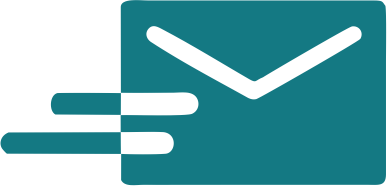04.04.2023
Kann Betriebliche Gesundheitsförderung die Attraktivität der Gesundheitsberufe steigern?
Ein Update zur Evidenzlage nach fünf Jahren
Prof. Dr. Eva Susanne Dietrich, Institut für evidenzbasierte Positionierung im Gesundheitswesen, Bonn
Bereits vor fünf Jahren wurde im Observer Gesundheit die Frage erörtert, ob durch eine Betriebliche Gesundheitsförderung die Attraktivität der Gesundheitsberufe erhöht werden kann, und es wurde ein Potential resümiert Eine Diskussion beim Bayerischen Landesgesundheitsrat zu diesem Thema (1) lieferte den Anlass zu überprüfen, ob zwischenzeitlich Evidenz vorliegt, um das Potenzial zu bestätigen. Das Ergebnis ist unbefriedigend.
Bevor man die vorhandene Evidenz zu Betrieblicher Gesundheitsförderung (BGF) bewertet, ist ein Blick auf die Vorgeschichte erforderlich. BGF bei nicht-medizinischen Gesundheitsberufen ist eine mittelbare Folge der Verkürzung der Krankenhausaufenthaltsdauer, der steigenden Anzahl polymorbider Patient:innen und dem Stellenabbau um die Jahrtausendwende. Anfang der 2000er Jahre wurden in zahlreichen Studien und Befragungen der Pflegenden die resultierenden Probleme dokumentiert und analysiert [z.B. (2–5)].
Etwas zuvor war auf europäischer Ebene die Rahmenrichtlinie über den Arbeitsschutz verabschiedet worden (6). Es folgten 1996 ein Gesetz zur nationalen Umsetzung dieser Richtlinie (7), 1999 das Gesundheitsreformgesetz mit Verankerung einer optionalen BGF (8) und 2007 die Luxemburger Deklaration, deren Ziel der EU-weite Austausch zu nachahmenswerten Praxisbeispielen einer BGF war (9).
Um die neuen Vorgaben zu operationalisieren, wurden Arbeitsgruppen und Initiativen wie INQA (Initiative Neue Qualität der Arbeit), DNBGF (Deutsches Netzwerk für Betriebliche Gesundheitsförderung), iga (Initiative Gesundheit und Arbeit) oder die Arbeitsgruppe 2 „Betriebliche Gesundheitsförderung“ ins Leben gerufen. Sie alle widmeten sich fortan Konzepten für die BGF und formulierten in den ersten Jahren nach der Jahrtausendwende zahlreiche Arbeits- und Positionspapiere, die teils auf alle Berufstätigen, teils auf Pflegekräfte fokussierten [z.B. (10–12)].
Für die Pflege wurden verschiedene Handlungsfelder identifiziert, die im Rahmen der BGF adressiert werden sollten (11). Umfassende rechtliche und strukturelle Vorgaben lieferten den Rahmen für BGF. Mit Blick auf die konkrete Umsetzung fanden sich jedoch eher allgemeine Vorschläge – angefangen von einer Sensibilisierung der Führungskräfte über Sportangebote hin zu Aktionstagen [z.B. (13, 14)]. Diverse Broschüren mit Praxisbeispielen sollten die Kreativität anregen [z.B. (14–16)]. Von evidenzbasierten strukturierten und standardisierten Interventionen war man zu diesem Zeitpunkt noch meilenweit entfernt, was auch im Entwurf zum Präventionsgesetz 2014 thematisiert wurde (17).
Evaluation von BGF
Um die Wirksamkeit bzw. den Nutzen einer Maßnahme zu messen, muss diese jedoch klar beschrieben werden. Gemäß PICO-Schema – gut bekannt aus der Nutzenbewertung von Arzneimitteln, aber auch in der Politikevaluation angewandt – sind eine Zielgruppe zu definieren, die Intervention im Detail zu beschreiben, eine Vergleichsgruppe ohne Intervention oder mit einer anderen Maßnahme heranzuziehen. Und schließlich werden relevante Ergebnisparameter a priori ausgewählt, gemessen und statistisch ausgewertet.
Welche Parameter sind das bei der BGF?
Der Gesetzgeber hat im § 20 SGB V sowohl konkrete als auch eher allgemeine Ziele definiert, die alle auf eine Gesundheitsförderung fokussieren. Im Gegensatz dazu finden sich in Papieren, die an Unternehmen adressiert sind, vollkommen andere Schwerpunkte. Von der Erhöhung der Leistungsfähigkeit ist da die Rede über mehr Flexibilität hin zu einem verbesserten Image [z.B. (13, 18)]. Die Krankenkassen wiederum formulieren in ihrem Leitfaden nach § 20 Abs. 2 SGB V weitgehend quantitative Zielparameter, mit denen zwar ihre Bemühungen gemessen werden können, jedoch nicht der zielgruppen-relevante Nutzen dieser Bemühungen (19). Es ist somit eine Reihe unterschiedlicher Ziele zu evaluieren, denn Evaluation ist nicht nur nach dem Willen des Gesetzgebers ein obligater Bestandteil von BGF.
Zur Methodik findet sich im „Leitfaden Prävention“ eine breit gefasste Formulierung: „Empfehlenswert ist die kombinierte Verwendung von prozess- und ergebnisbezogenen Indikatoren sowie von objektiven Daten und subjektiven Einschätzungen als Evaluationskriterien.“ (20) Die wissenschaftliche Fachliteratur hat hingegen mit den RE-AIM-Dimensionen recht präzise Vorstellungen entwickelt, wie die Evaluation von BGF aussehen sollte – und das bereits seit den 1990er Jahren (21): Wird die Zielgruppe erreicht (Reach), wie ist die Wirksamkeit (Efficacy), werden die Interventionen von vielen Organisationen in der Folge übernommen (Adaption), werden sie so umgesetzt wie geplant (Implementation), und hält die Wirkung über eine längere Zeit an (Maintenance)? Als Studiendesigns sollten – wie in der Medizin auch – randomisierte Studien (RCT) eingesetzt werden – so zumindest der internationale Konsens i.S. Best Practice (22).
Evidenzlage
Wie sind nun die Effekte mit Blick auf diese fünf Dimensionen?
Nun, das wissen wir nicht, denn die (wissenschaftlichen?) Evaluationen der Einzelprojekte sind nicht öffentlich zugänglich. In den diversen Broschüren, die BGF bewerben, finden sich lediglich Aussagen wie „BGF kommt gut an“, „Die Fehlzeiten wurden verringert“ oder „Die Beschäftigten fangen an, ihre Arbeit zu reflektieren.“ Das hilft nicht weiter. Wir erfahren nichts über die RE-AIM-Kategorien, deren Messung und die Outcomes.
Auch die Präventionsberichte der Kassen helfen nicht weiter. Die Anzahl erreichter Betriebe sagt nichts darüber aus, welche BGF-Maßnahmen erfolgreich waren, und lässt – in Anlehnung an den AMNOG-Jargon – keine Quantifizierung des Zusatznutzens der einzelnen Maßnahmen zu.
Doch es gibt durchaus Evidenz zum Nutzen von BGF bei Pflegekräften.
In den letzten Jahren haben diverse Autor:innen und Institutionen systematische Suchen nach Literatur rund um BGF durchgeführt (23–32). Auffallend ist hierbei, dass die älteren Arbeiten so gut wie keine deutschen Studien identifizierten und alle Reviews die Methodik der Untersuchungen heftig kritisieren. Das Verzerrungspotential sei hoch, die Berichtsqualität schlecht, die Interventionen nicht standardisiert, die Populationen zu heterogen und die Nachbeobachtungszeiten zu kurz. Die sicherlich interessanteste Übersichtsarbeit zur hier interessierenden Frage stammt von Frau Prof. Schaller von der Deutschen Sporthochschule in Köln (32). In ihrem systematischen Review mit Stichtag Januar 2021 suchte sie nach interventionellen Studien ab 2010 zu BGF bei deutschen Pflegekräften im Krankenhaus und der stationären sowie häuslichen Langzeitpflege.
Unter den elf identifizierten Studien waren fünf RCT und drei mit quasi-experimentellem Design. Das Verzerrungspotential war extrem hoch. Die Reichweite wurde in drei Studien nicht berichtet und lag in den anderen Studien zwischen 9 und 200 Personen. Die Wirksamkeit wurde in sogar vier Studien nicht berichtet. In den anderen fanden sich überwiegend nicht signifikante Ergebnisse vs. den Vergleichsgruppen. Die Maßnahmen wurden von zwischen ein und elf Zentren übernommen. Vier Studien berichteten jedoch nichts darüber. Zur Implementierung, also zur Frage, ob die Maßnahmen in der geplanten Form in der Folge umgesetzt wurden, berichteten neun Studien nichts. Und auch über die längerfristigen Effekte liegen nur aus vier Studien gewisse Informationen vor.
Ein spezielles Problem der BGF bei Gesundheitsberufen wurde in einer Untersuchung der Helios-Kliniken sehr gut ausgearbeitet. Danach brachen Beschäftigte im stationären Schichtdienst die Maßnahmen besonders häufig ab und nahmen die Angebote auch unterdurchschnittlich häufig an (33).
Es werden dafür mögliche Gründe angeführt, die auf der Hand liegen: Selbst, wenn die Führungskräfte die Beschäftigten offiziell für Coachings, Sportkurse und ähnliches freistellen, nutzen diese die Angebote nicht, weil schlichtweg die Zeit fehlt, oder es den Kolleg:innen gegenüber, die den Arbeitsausfall kompensieren müssen, unfair wäre. Zahlreiche Gründe, warum eine BGF in Kliniken generell schwer umzusetzen ist, hat die Hans-Böckler-Stiftung bereits 2009 zusammengestellt (34). Und damit schließt sich der Kreis. Erneut werden Probleme erkannt und breit analysiert (35–42). Erneut entstehen Positionspapiere und BGF wird gefordert (43).
Neu sind spezifische Angebote für Pflegekräfte, bevorzugt mit leerzeichenreduzierten Bezeichnungen wie MEHRWERT:PFLEGE (44), Pflege.Kräfte.Stärken. (45), gesaPflege (46) und – was relevanter ist – weitgehend basierend auf Trial and Error, also Erfahrungen und selten auf evidenzbasierten Auswertungen oder gar RCT wie oben beschrieben. Es wird abzuwarten sein, ob diese in Zukunft vorliegen. Eine aktuelle Publikation zu BGF zeigt ab 2008 eher einen Rückgang entsprechender Evaluationen (31).
Kann BGF bei der Bekämpfung des Fachkräftemangels helfen?
Auf Basis der vorliegenden Evidenz ist die Beantwortung dieser Frage sicherlich nicht möglich. Wir wissen aus den Studien meist wenig Näheres zur Zielpopulation, extrem wenig zur Intervention und wie sie im Detail umgesetzt wurde, wer sie betreute, wie sie vorbereitet worden war. Wir haben vielfach keine wissenschaftlich hochwertigen Auswertungen zu den Effekten, und wir wissen meist auch nicht, ob die Maßnahmen fortgeführt wurden, d.h. ob sie so nutzbringend waren, dass sie in dieser oder auch veränderter Form beibehalten oder von anderen Institutionen übernommen wurden. Noch weniger wissen wir, ob die Institutionen dadurch neues Personal anwerben oder altes halten konnten. Die Bedarfe von medizinischen Fachangestellten und Kleinbetrieben bleiben zudem komplett außen vor.
Überdies ist fraglich, ob beispielsweise ein kostenloser Kitaplatz in einer Klinik nicht wesentlich attraktiver ist als Coaching-Sitzungen zur Stärkung der Resilienz. Ob also andere Maßnahmen letztendlich viel effektiver sind, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen. Aus der Gesundheitspolitik wissen wir jedoch auch, dass es für die meisten Problemstellungen keine Panazee gibt, sondern multimodale Ansätze benötigt werden.
Somit können einzelne BGF-Angebote neben anderen Kriterien durchaus zum Alleinstellungsmerkmal einer Klinik oder Gesundheitseinrichtung avancieren. Vorausgesetzt, sie sind für die Zielgruppe attraktiv und mit den Arbeitsabläufen kompatibel, und sie werden vor allem dauerhaft implementiert und aktiv bei der Personalsuche beworben. Unabhängig davon braucht es jedoch mehr Evidenz und Transparenz.

Ein wichtiger Schritt wäre eine öffentlich zugängliche Datenbank, wie wir sie von Arzneimittelstudien kennen. ClinicalTrials.gov liefert hier eine hervorragende Blaupause. Eine simple (Einstiegs-) Variante wäre ein Verzeichnis wie das „Register nicht-interventioneller Studien“ des vfa. In einem solchen Register könnten nicht nur die Rahmendaten der Projekte wie PICOS-Schema, angestrebte und tatsächliche Teilnehmerzahlen, Start und Evaluationszeitpunkt übersichtlich dargestellt, sondern auch die zentralen Ergebnisse standardisiert hinterlegt sowie Publikationen verlinkt werden.
Der Appell von 2018 hat damit nach wie vor Gültigkeit: Die BGF-Maßnahmen sollten mit den international anerkannten Methoden der evidenzbasierten Medizin – mit besonderem Fokus auf die RE-AIM-Dimensionen – evaluiert und die Ergebnisse der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.
Literatur
- Bayerischer Landesgesundheitsrat. Tagesordnung für die 3. Sitzung des Unterausschusses des Bayerischen Landesgesundheitsrates zum Thema „Chancen und Möglichkeiten zur Steigerung der Attraktivität der (nichtärztlichen) Medizinberufe“ am 06.03.2023 um 11:00 Uhr; 2023 [Stand: 11.03.2023].
- Deutsches Institut für angewandte Pflegeforschung e.V. Pflege -Thermometer 2002: Frühjahrsbefragung zur Lage und Entwicklung des Pflegepersonalwesens in Deutschland; 2002 [Stand: 27.02.2023]. Verfügbar unter: https://www.dip.de/fileadmin/data/pdf/material/Pflege-Thermometer%25202002.pdf.
- Marstedt G. Massiver Abbau von Pflegepersonal in Kliniken: Eine Gefahr für die Patientensicherheit?: Forum Gesundheitspolitik; 2007 [Stand: 27.02.2023]. Verfügbar unter: https://www.forum-gesundheitspolitik.de/artikel/artikel.pl?artikel=0827.
- Braun B, Müller R, Timm A. Gesundheitliche Belastungen, Arbeitsbedingungen und Erwerbsbiografien von Pflegekräften im Krankenhaus: Eine Untersuchung vor dem Hintergrund der DRG-Einführung. Sankt Augustin: Asgard; 2004. (GEK-Edition; Bd. 32) [Stand: 27.02.2023]. Verfügbar unter: http://forum-gesundheitspolitik.de/dossier/PDF/pflegekraefte-report_1.pdf.
- Bundesamt für Gesundheit. RICH-Nursing-Study Rationing of Nursing Care in Switzerland: Effects of Rationing of Nursing Care in Switzerland on Patients` and Nurses` Outcomes; 2005 [Stand: 24.02.2023].
- Richtlinie des Rates vom 12. Juni 1989 über die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer bei der Arbeit (89 / 391 /EWG); 1989 [Stand: 28.02.2023]. Verfügbar unter: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:31989L0391&from=DE.
- Gesetz zur Umsetzung der EG-Rahmenrichtlinie Arbeitsschutz und weiterer Arbeitsschutz-Richtlinien; 1996 [Stand: 28.02.2023]. Verfügbar unter: https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/text.xav?SID=&tf=xaver.component.Text_0&tocf=&qmf=&hlf=xaver.component.Hitlist_0&bk=bgbl&start=%2F%2F*%5B%40node_id%3D%27959225%27%5D&skin=pdf&tlevel=-2&nohist=1&sinst=3F5F5C4B.
- Gesetz zur Reform der gesetzlichen Krankenversicherung ab dem Jahr 2000: GKV-Gesundheitsreformgesetz 2000; 1999 [Stand: 02.03.2023].
- European Network For Workplace Health Promotion. Luxemburger Deklaration zur betrieblichen Gesundheitsförderung in der Europäischen Union; 2007 [Stand: 26.02.2023].
- Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Krankenkassen. Gemeinsame und einheitliche Handlungsfelder und Kriterien der Spitzenverbände der Krankenkassen zur Umsetzung von § 20 Abs. 1 und 2 SGB V vom 21. Juni 2000 in der Fassung vom 12. September 2003; 2003 [Stand: 28.02.2023]. Verfügbar unter: http://www.gesundheitsfoerdernde-hochschulen.de/Inhalte/B_Basiswissen_GF/B9_Materialien/B9_Dokumente/Dokumente_national/Handlungsfelder_Spitzenv_KK.pdf.
- Initiative Neue Qualität der Arbeit, Hrsg. Für eine neue Qualität der Arbeit in der Pflege: Leitgedanke einer gesunden Pflege ; Memorandum. Dortmund; 2005.
- Arbeitsgruppe 2 „Betriebliche Gesundheitsförderung“. Positionspapier; 2009 [Stand: 26.02.2023].
- Deutscher Industrie- und Handelskammertag e. V. Betriebliche Gesundheitsförderung – Checkheft für kleine und mittlere Unternehmen; 2016 [Stand: 27.02.2023]. Verfügbar unter: https://www.ihk-muenchen.de/ihk/checkheft-gesundheitsfoerderung-2-(1)-(3).pdf.
- Bundesministerium für Gesundheit. Praxisseiten Pflege: Wir stärken die Pflege. Gemeinsam.; 2015 [Stand: 28.02.2023]. Verfügbar unter: https://vincenzhaus-oberhausen.de/download/Praxisseiten%20Pflege%20Info%20des%20Bundesministeriums%20f%C3%BCr%20Gesundheit.pdf.
- Bundesministerium für Arbeit und Soziales. GUTE PRAXIS Gesundheit und Teilhabe in der Arbeitswelt 4.0: Sammlung betrieblicher Gestaltungsbeispiele: Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS); 2017 [Stand: 26.02.2023].
- Redaktion. Gesundheitsförderung für Pflegekräfte: Wer pflegt die Pflege?: Lösungsansatz: Betriebliche Gesundheitsförderung für Pflegekräfte. Praxisseiten Pflege 2017; (6):1–8.
- Gesetzentwurf der Bundesregierung. Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention: Präventionsgesetz – PrävG [Drucksache 640/14] 2014 [Stand: 02.03.2023]. Verfügbar unter: https://dserver.bundestag.de/brd/2014/0640-14.pdf.
- Lilie O. Betriebliches Gesundheitsmanagement im Unternehmen: Was ist BGM?; 2013 [Stand: 28.02.2023]. Verfügbar unter: https://www.perwiss.de/gesundheitsmanagement.html#ziele.
- GKV Spitzenverband, Medizinischer Dienst Bund. Präventionsbericht 2022 (Berichtsjahr 2021); 2022 [Stand: 24.02.2023]. Verfügbar unter: https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/krankenversicherung_1/praevention__selbsthilfe__beratung/praevention/praeventionsbericht/2022_GKV_MDS_Praeventionsbericht_barrierefrei.pdf.
- GKV-Spitzenverband. Leitfaden Prävention nach § 20 Abs. 2 SGB V und Leitfaden Prävention nach § 5 SGB XI; 2021 [Stand: 28.02.2023]. Verfügbar unter: https://www.vdek.com/LVen/HAM/Vertragspartner/Praevention_und_Vorsorge/_jcr_content/par/publicationelement_1169376070/file.res/Leitfaden_Pravention_2021.pdf.
- Glasgow RE, Vogt TM, Boles SM. Evaluating the public health impact of health promotion interventions: the RE-AIM framework. Am J Public Health 1999; 89(9):1322–7. doi: 10.2105/ajph.89.9.1322.
- Friedrich V, Hoffmann S, Bauer G. Beyond Efficacy Die Evaluation von Massnahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung anhand der RE-AIM Dimensionen. Münster; 2009. (DeGEval) [Stand: 02.03.2023]. Verfügbar unter: https://www.degeval.org/fileadmin/jahrestagung/Muenster_2009/Session_BLOCK_A/Beyond_Efficacy__Friedrich.pdf.
- Romppanen J, Häggman-Laitila A. Interventions for nurses‘ well-being at work: a quantitative systematic review. J Adv Nurs 2017; 73(7):1555–69. doi: 10.1111/jan.13210.
- Guillaumie L, Boiral O, Champagne J. A mixed-methods systematic review of the effects of mindfulness on nurses. J Adv Nurs 2017; 73(5):1017–34. doi: 10.1111/jan.13176.
- Brand SL, Thompson Coon J, Fleming LE, Carroll L, Bethel A, Wyatt K. Whole-system approaches to improving the health and wellbeing of healthcare workers: A systematic review. PLoS One 2017; 12(12):e0188418. doi: 10.1371/journal.pone.0188418.
- Barthelmes I, Bödeker W, Sörensen J, Kleinlercher K-M, Odoy J. Wirksamkeit und Nutzen arbeitsweltbezogener Gesundheitsförderung und Prävention: Zusammenstellung der wissenschaftlichen Evidenz 2012 bis 2018; 2019. iga.Report 40 [Stand: 24.02.2023]. Verfügbar unter: https://www.dnbgf.de/fileadmin/downloads/materialien/dateien/2019_iga.Report_Metastudie-GF-Praev.pdf.
- Pieper C, Schröer S, Bräunig D, Kohstall T. Wirksamkeit und Nutzen betrieblicher Prävention: Wirksamkeit und Nutzen betrieblicher Gesundheitsförderung und Prävention – Zusammenstellung der wissenschaftlichen Evidenz 2006 bis 2012; Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit des betrieblichen Arbeitsschutzes – Zusammenstellung der wissenschaftlichen Evidenz 2006 bis 2012; 2015. iga.Report 28 [Stand: 27.02.2023].
- Schreiber E. Gesundheitsförderung in Krankenhäusern: Ergebnisse eines Systematischen Reviews mit dem Fokus auf Pflegende; Bachelor-Thesis: Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg; 2014 [Stand: 27.02.2023].
- Chan CW, Perry L. Lifestyle health promotion interventions for the nursing workforce: a systematic review. J Clin Nurs 2012; 21(15-16):2247–61. doi: 10.1111/j.1365-2702.2012.04213.x.
- Buchberger B, Heymann R, Huppertz H, Friepörtner K, Pomorin N, Wasem J. Effektivität von Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF) zum Erhalt der Arbeitsfähigkeit von Pflegepersonal: DIMDI; 2011 [Stand: 24.02.2023].
- Blumentritt S, Luig T, Enklaar A, Englert H. Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) im Laufe der Zeit. Präv Gesundheitsf 2023. doi: 10.1007/s11553-023-01018-7.
- Schaller A, Gernert M, Klas T, Lange M. Workplace health promotion interventions for nurses in Germany: a systematic review based on the RE-AIM framework. BMC Nurs 2022; 21(1):65. doi: 10.1186/s12912-022-00842-0.
- Heinrich C. Berufsgruppenübergreifende Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) im Gesundheitswesen. Arbeitsmed Sozialmed Umweltmed 2016; (51):587–92.
- Müller B. Betriebliches Gesundheitsmanagement im System Krankenhaus – Bestandsaufnahme und Ausblick; 2009 [Stand: 27.02.2023].
- Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Stressreport Deutschland 2019: Psychische Anforderungen, Ressourcen und Befinden; 2020 [Stand: 26.02.2023]. Verfügbar unter: https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Berichte/Stressreport-2019.html.
- Redaktion. Mehr als ein Viertel der Pflegebeschäftigten gibt an, längerfristig kaum weiter arbeiten zu können. ASU 2017; 52 [Stand: 26.02.2023]. Verfügbar unter: https://www.asu-arbeitsmedizin.com/aktuelles/im-brennpunkt-mehr-als-ein-viertel-der-pflegebeschaeftigten-gibt-laengerfristig-kaum.
- Suhr F. Deutsche Krankenpfleger am Limit; 2019 [Stand: 02.03.2023]. Verfügbar unter: https://de.statista.com/infografik/16676/patientenzahl-pro-pflegekraft-im-internationalen-vergleich/.
- OECD. Who Cares? Attracting and Retaining Elderly Care Workers: OECD; 2020.
- World Economic Forum. The world needs 6 million new nurses by 2030; 2020 [Stand: 27.02.2023]. Verfügbar unter: https://www.weforum.org/agenda/2020/07/world-nursing-report-recruitment-shortages-who-2030/.
- Ehegartner V, Kirschneck M, Frisch D, Schuh A, Kus S. Arbeitsfähigkeit von Pflegekräften in Deutschland – welchen Präventionsbedarf hat das Pflegepersonal: Ergebnisse einer Expertenbefragung. Gesundheitswesen 2020; 82(5):422–30. doi: 10.1055/a-0905-3007.
- Lützerath J, Bleier H, Stassen G, Schaller A. Influencing factors on the health of nurses-a regression analysis considering individual and organizational determinants in Germany. BMC Health Serv Res 2023; 23(1):100. doi: 10.1186/s12913-023-09106-2.
- Bleier H, Lützerath J, Schaller A. Organizational Framework Conditions for Workplace Health Management in Different Settings of Nursing-A Cross-Sectional Analysis in Germany. Int J Environ Res Public Health 2022; 19(6). doi: 10.3390/ijerph19063693.
- Klapper B. Zukunft für die Pflegeberufe: Chancen und Herausforderungen. Berlin; 2022. (Pressekonferenz) [Stand: 24.02.2023]. Verfügbar unter: https://www.bkk-dachverband.de/fileadmin/Artikelsystem/BKK_Gesundheitsreport/Gesundheitsreport_2022/20221207_BKK_Pressekonferenz_Klapper.pdf.
- Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek). Mehrwert:Pflege Ein Angebot der Ersatzkassen zur betrieblichen Gesundheitsförderung; 2023 [Stand: 02.03.2023]. Verfügbar unter: https://www.mehrwert-pflege.com/.
- AOK-Bundesverband. Pflege.Kräfte.Stärken.; 2023 [Stand: 02.04.2023]. Verfügbar unter: https://www.aok-bv.de/engagement/pflege_kraefte_staerken/.
- Team Gesundheit GmbH, AOK Rheinland/Hamburg, BARMER Landesvertretung Nordrhein-Westfalen. gesaPflege; 2023 [Stand: 02.04.2023]. Verfügbar unter: https://www.gesapflege.de/.
_observer.jpg)
Alle Beiträge Management/Wissenschaft ansehen